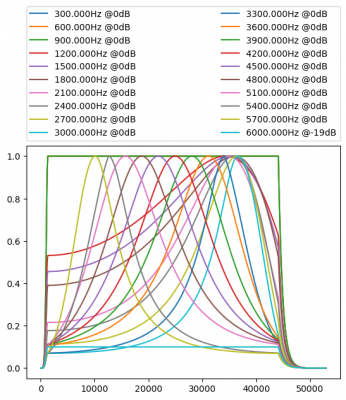1) Ich erzeuge mir durch die Mischung von vier Sinusschwingungen mit den Frequenzen f, 2f, 3f und 5f ein Klangspektrum: Das ist additive Synthese, denn ich habe vollen Zugriff auf und unabhängige Kontrolle über jeden einzelnen sinusförmigen Bestandteil des Klangspektrums.
2) Nun nehme ich das Beispiel (1), nur das die Schwingung 5f nicht mehr von einem Sinusoszillator erzeugt wird, sondern von einem 2-Operatoren-FM-Pärchen, das nun auch keinen Sinus mehr erzeugt, sondern eine komplexe Schwingung mit eigener reichhaltiger Obertonstruktur. Hier habe ich es mit einer Mischung aus additiver Synthese (voller Teiltonzugriff für die drei Sinusoszillatoren f, 2f und 3f) und 2-Operatoren-FM zu tun – denn bei der FM habe ich eben nicht mehr die volle unabhängige Kontrolle über jeden einzelnen sinusförmigen Bestandteil des FM-Klanges.
3) Schließlich stelle man sich Beispiel (2) erneut vor, aber mit einer entscheidenden Änderung: Statt die Schwingung von 5f über klassische FM (also FM des Carriers durch den Modulator) zu erzeugen, wird auch diese Schwingungsform additiv erzeugt, nämlich über ein entsprechendes Makro, das dem Benutzer zwar die Parameter der FM zur Verfügung stellt, das Ergebnis dieser FM aber als additives Spektrum erzeugt. In diesem Falle ist das Ergebnis "additive Synthese" zu nennen, da der Anwender auf Wunsch vollen unabhängigen Zugriff auf jeden einzelnen sinusförmigen Klangbestandteil hat – wenn er das FM-Makro für 5f abschaltet, nachdem er darüber das Ergebnis einer FM als additives Spektrum hat erzeugen lassen.
Und jetzt werde ich bei einer Tasse Tee dem draußen niedergehenden Regen lauschen und mich fragen, ob ich dazu "Granularsynthese" sagen darf.
Ich bin da an einer Stelle etwas anderer Ansicht, aber ich will eigentlich nicht den Thread mit meinen Überlegungen belasten. Zumindest bisher hatte ich die Sache folgendermaßen verstanden, und die Terminologie folgendermaßen benutzt:
Der Unterschied zwischen einem Einzelton mit verschiedenen harmonischen Obertönen und einem Akkord, der nur die Töne einer Obertonreihe umfasst, ist eigentlich der, dass die Partialtöne des Einzeltons alle immer in Phase sind. Daher war für mich bisher Additive Synthese eine solche, bei der es gelingt, diese Obertöne in Phase zu erzeugen.
Wenn ich also zu einem Einzelton mit Frequenz f und Obertönen 2f, 3f,
"n"f einen zweiten Ton hinzu mische, sagen wir mit Frequenz 3f, der durchaus auch Obertöne haben darf (also 6f, 9f, 12f, …), und es gelingt mir, diesen Ton in Phase beizumischen, dann hört man im Gesamten einen einzelnen Ton, und das ist für mich durchaus additive Synthese. Das ist eben mehr als was ein Mischpult kann! Ob, wie serge schreibt, "der Anwender auf Wunsch vollen unabhängigen Zugriff auf jeden einzelnen sinusförmigen Klangbestandteil hat", wäre für mich zweitrangig. Erstens, weil ja auch nachträglich nicht mehr feststellbar ist, ob das der Fall war. Zweitens, weil die Symtheseart sich nicht dadurch ändert, dass der Anwender vielleicht die Teiltöne 65 und 67 nur gemeinsam in der Lautstärke beeinflussen kann. Zumindest wäre eine Definition per diesem Detail für mich etwas akademisch…
Das heißt, ich hätte diese Syntheseart weniger über die Anzahl der Regler für den Anwender als über das Ergebnis definiert.
Soweit mein Verständnis. Ich wollte eigentlich damit nicht nach Wochen im Forum die Diskussion sprengen, aber es nagt nun doch an mir…
Für die Diskussion (die ich aber kaum verfolge, weil die Schreiber wie immer viel zu disziplinlos durcheinanderreden) hilft vielleicht noch folgender Gedanke: Wenn ich die "odd"-Obertöne als Gruppe bearbeiten kann, heißt das ja, dass ich einen Ton der Frequenz 2f hinzumischen kann und in der Lautstärke mit allen Obertönen unter Kontrolle habe. Wie wäre es nun mit den weiteren primzahligen Tönen? 3f mit Obertönen, 5f mit Obertönen, 7f mit Obertönen, 11f mit Obertönen? Ich bin sicher, dass ich mit jedem derartigen Regler ein sehr charakteristisches Element des resultierenden Klangs beeinflussen kann. Wenn ich dazu noch ein paar gängige Obertonlautstärkeverläufe für jeden davon auswählen kann (wie etwa 3f, 9f, 15f, 21f, also nur ungeradzahlige Vielfache des hinzugefügten Frequenz 3f, sind ja "untereinander" eine Rechteckschwingung), dann müsste das doch reichen, oder? Je ein Regler für die ersten soundsoviele primzahligen Obertöne, dazu dort ein Auswahlschalter zwischen vier oder fünf Standard-Wellenformen (mithin jeweils einer charakteristischen Schar von Obertönen), dann müsste ich doch schon ein Stück weiter kommen, oder?
Dazu braucht man dann zuletzt noch einen Regler wie "even", hier also nun die verbleibenden, hohen, primzahligen Obertöne als Ganzes.